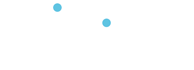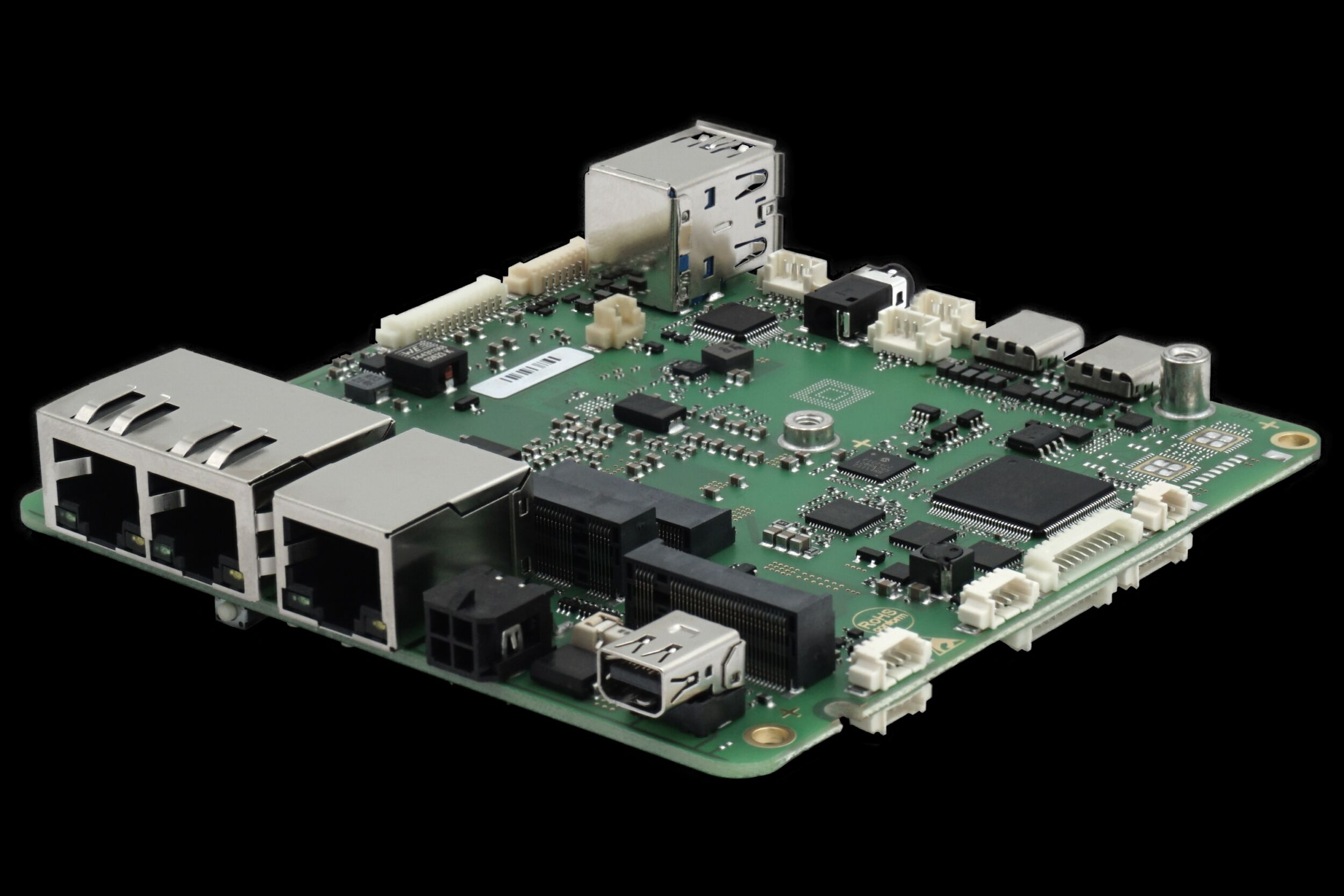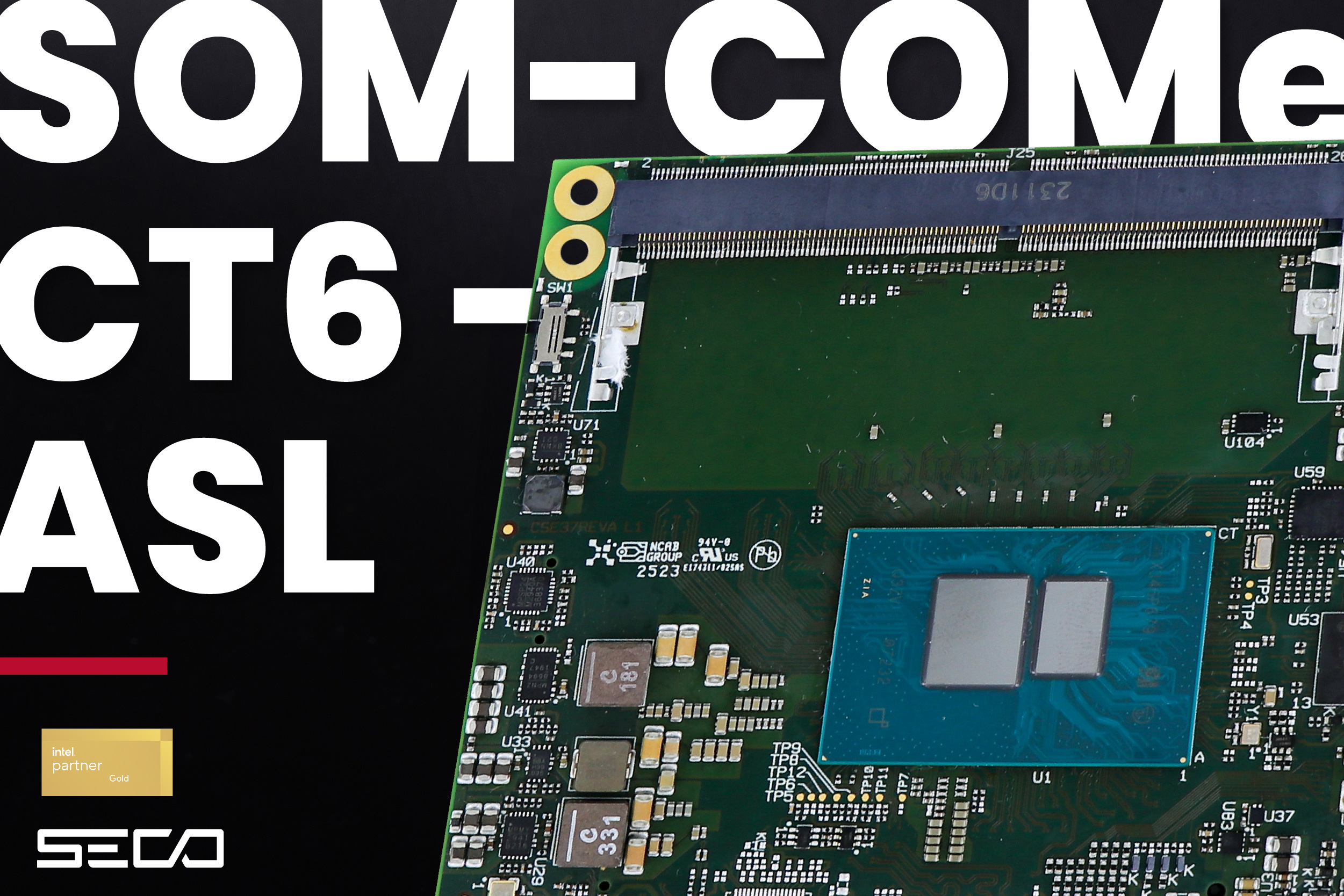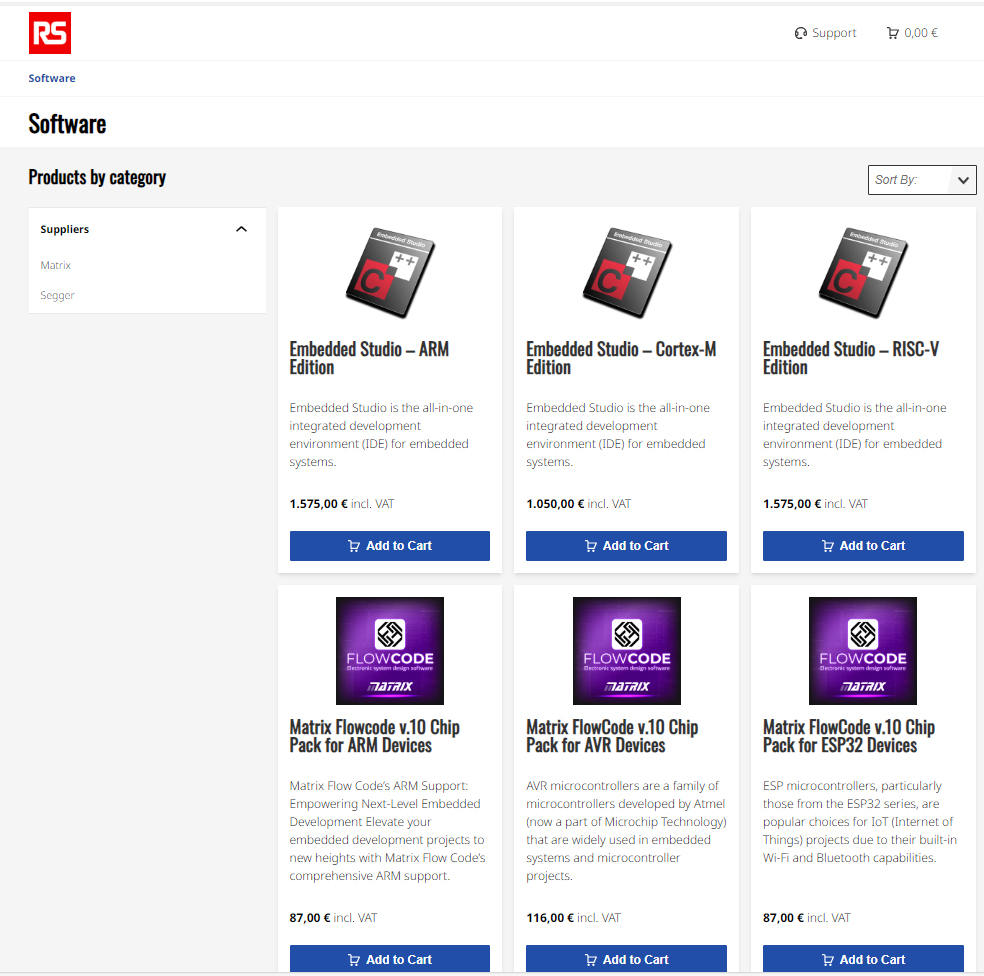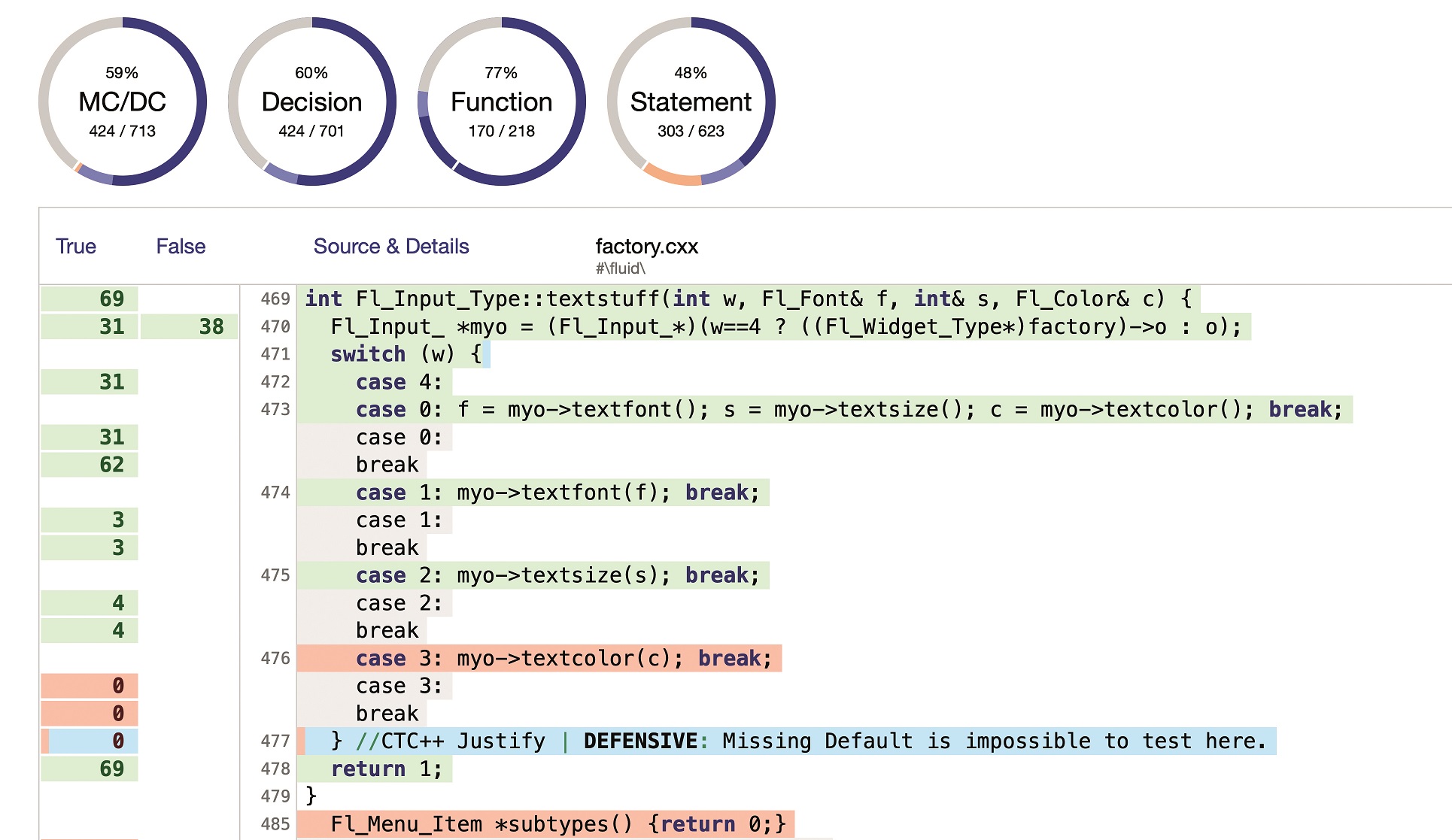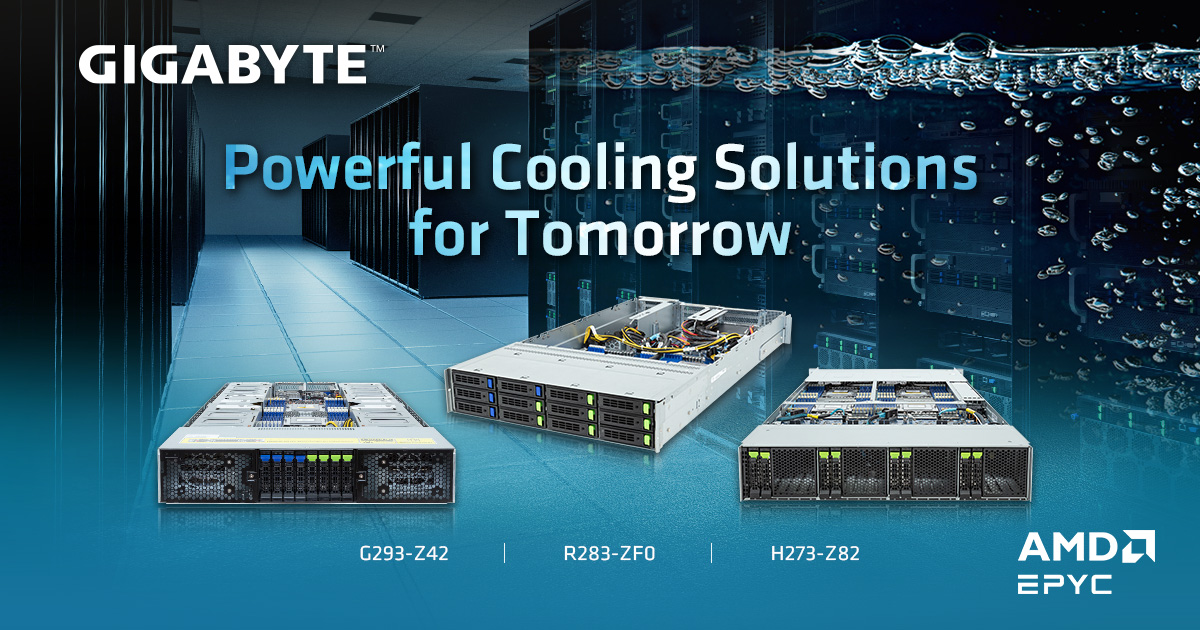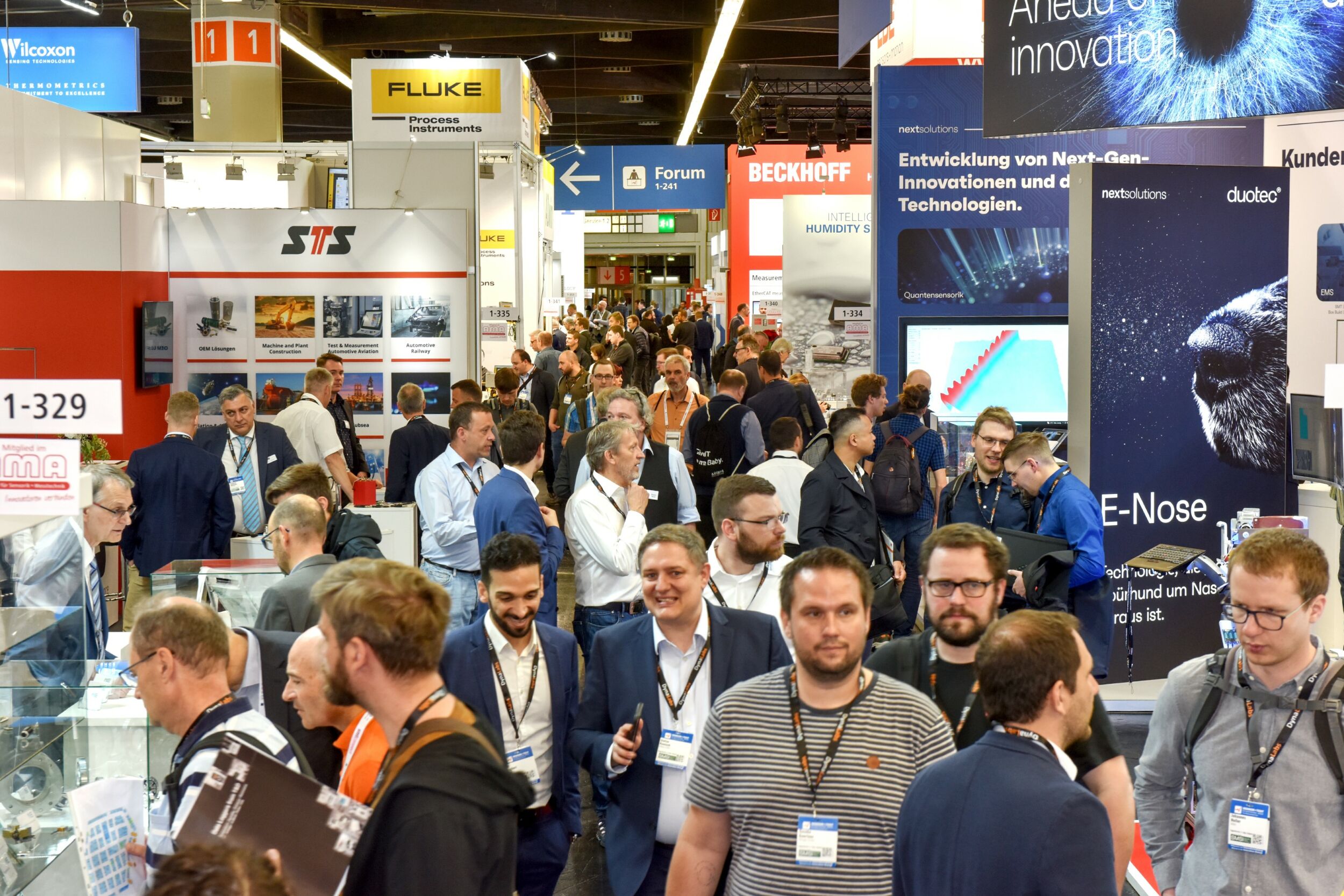Mit einem 3D-Drucker können beliebige dreidimensionale Gegenstände erzeugt werden. Forscherinnen und Forschern des KIT ist es nun im Rahmen eines DFG-Projektes erstmals gelungen, mit einem handelsüblichen 3D-Drucker das Metall Wolfram zu drucken, das wegen seines hohen Schmelzpunktes von 3.400°C beispielsweise bei Turbinenschaufeln von Düsentriebwerken Verwendung findet.
Beim Fertigen von Kunststoffbauteilen mit einem 3D-Drucker wird das Material geschmolzen und dann Schicht für Schicht gedruckt. „Wir haben dieses Verfahren jetzt auf die Herstellung von Bauteilen aus Wolfram angepasst“, sagen Steffen Antusch und Dorit Nötzel vom Institut für Angewandte Materialien des KIT. Dafür verwenden sie Wolfram in Pulverform und vermischen es mit einem Bindersystem. Daraus entsteht das sogenannte Filament – ein Faden, der in den 3D-Drucker eingesetzt und aus dem das Bauteil gedruckt wird. „Um ein möglichst reines Wolfram-Bauteil zu erhalten, müssen wir nach dem Druck das Bindersystem wieder entfernen“, so Nötzel. Dafür werden die gedruckten Objekte auf über 2.000°C erhitzt. Während dieser thermischen Nachbehandlung verbinden sich die einzelnen Wolfram-Pulverkörner und schließen sich so zu einem Bauteil zusammen. Aufgrund seiner hohen Korrosionsbeständigkeit ist Wolfram ein idealer Werkstoff für Apparaturen in chemischen Anlagen. Durch seine Härte und den hohen Schmelzpunkt ist es aber sehr schlecht zu bearbeiten. „Mithilfe des 3D-Drucks können wir jetzt schneller und einfacher Bauteile aus Wolfram herstellen, die – beispielsweise in der Fusionstechnologie innerhalb des HGF-Programms ‚Fusion‘ oder in der Medizintechnik – Anwendung finden“, sagt Antusch.